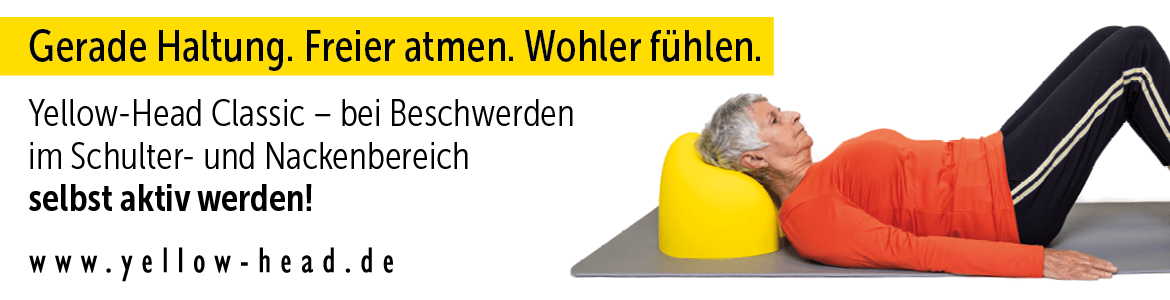Die Perkutane Vertebroplastie – ein erfolgreiches minimal-invasives Verfahren zur Behandlung des akuten und chronischen Rückenschmerzes

Dr. med. Thorsten Hennigs (Orthopädie an der Rennbahn Frankfurt)
Plötzliche heftige Rückenschmerzen sind nicht selten Folge eines Wirbelkörperbruchs. Dabei können vorgeschädigte Knochen schon aus geringem Anlass, etwa bei einem Stoß oder einem leichten Sturz brechen. Besonders häufig ist dies der Fall bei Menschen mit Osteoporose. Aber auch Patienten mit Wirbelhämangiomen (Blutschwamm im Wirbelkörper), Plasmozytom/Multiples Myelom (Tumor des Knochenmarks) oder Wirbelmetastasen sind gefährdet, solche Wirbelkörperbrüche aus geringem Anlass zu erleiden. Bedeutete diese Diagnose früher wochen- oder gar monatelange Ruhigstellung, teilweise nach einer aufwendigen Stabilisierungsoperation mit Metallstäben (Spondylodese) sowie anschließend das Tragen eines Mieders, kann diesen Menschen heute schneller und effektiver zur Verringerung der Schmerzen und zu einer verbesserten Mobilität verholfen werden.
Mit der Perkutanen Vertebroplastie steht eine moderne und wenig invasive Methode zur erfolgreichen Behandlung verschiedener schmerzhafter Wirbelerkrankungen zur Verfügung. Man versteht darunter eine Methode, bei der mit Hilfe eines speziellen Knochenzements eine Stabilisierung der Wirbelsäule erreicht wird. Dieses neue Verfahren ist insbesondere bei osteoporotischen Wirbelfrakturen mit Grund- und Deckplatteneinbrüchen oder kompletten Kompressionsfrakturen geeignet.
Während in den USA und in manchen europäischen Ländern, z.B. der Schweiz und Frankreich, die Vertebroplastie bereits ein verbreitetes und stetig zunehmendes Behandlungsverfahren ist, gibt es in Deutschland bislang nur wenige Zentren, die dieses Verfahren anbieten. Zudem gibt es hierzulande auch nur wenig Informationen über die Methode selbst.
Prinzipiell ist jede Art von Wirbelfraktur mit dieser Methode behandelbar. Hauptindikation sind sicherlich Wirbelbrüche bei Osteoporose. Wirbelhämangiome und Wirbelmetastasen sind seltenere Indikationen, lassen sich aber genauso erfolgreich therapieren. Sowohl frische als auch alte Frakturen sprechen gut auf die Therapie an, doch je kürzer der Bruch zurückliegt, desto effektiver ist die Methode. Es können nicht nur Grund- und Deckplatteneinbrüche, sondern auch komplexe Kompressionsfrakturen bis hin zum völlig zusammengesinterten Flachwirbel behandelt werden. Die einzige Einschränkung ist die Beteiligung der Wirbelhinterkante mit Einbruch in den Rückenmarkskanal, weil dann unter Umständen die Möglichkeit besteht, dass es bei der Operation durch austretenden Zement zu einer Irritation des spinalen Nervensystems kommen könnte. In diesen Fällen empfiehlt sich unter Umständen die offene Spondylodese im Rahmen eines stationären Aufenthaltes.
Der Eingriff wird normalerweise in örtlicher Betäubung ambulant durchgeführt. Auf Grund der Bauchlage empfiehlt sich eine stärkere Sedierung (medikamentöse Beruhigung) unter anästhesiologischer Überwachung. Diese Sedierung kann bis zum tiefen Schlaf des Patienten ausgeweitet werden, falls er nichts von der Operation mitbekommen möchte. Zusätzlich zur Lokalanästhesie können auch Schmerzmittel intravenös verabreicht werden, so dass die Patienten keine Schmerzen verspüren.
Der Zugang zu den erkrankten Wirbeln erfolgt während der Operation vom Rücken her unter laufender Röntgenkontrolle. Es werden je nach Anzahl der zu behandelnden Wirbelkörper nur kleine, etwa 1 cm lange Hauteinstiche vorgenommen, über die dann eine Hohlnadel eingebracht wird. Nach Platzierung dieser dünnen Hülse im vorderen Drittel des Wirbelkörpers wird der frisch angerührte, sterile und flüssige Zement (PMMA, Polymethyl-Methacrylate; z.B. BIOMET MERCK, GmbH) injiziert. Dieser Zement ist im Wesentlichen der gleiche, der seit Jahrzehnten zum Einzementieren von Gelenkprothesen Verwendung findet. Die Injektion erfolgt ebenfalls unter laufender Röntgenkontrolle mittels digitaler Durchleuchtung, so dass die Zementeingabe gut kontrollierbar ist. Das CT-gesteuerte Vorgehen ist weniger empfehlenswert, da die Zementinjektion unter Durchleuchtungskontrolle in »real time« (also ohne zeitliche Verzögerung) erfolgen sollte und im CT eventuell zu spät erkannt wird, ob Zement über die Hinterkante in den Spinalkanal austritt. Der anfänglich sehr flüssige Zement verteilt sich in der gesamten Wirbelspongiosa, der inneren Knochenmasse, und härtet innerhalb weniger Minuten komplett aus. Es können so in einer Sitzung mehrere Wirbelkörper mit dem Knochenzement ausgefüllt und damit stabilisiert werden. Ferner können angrenzende Wirbelkörper mit ebenfalls hohem Frakturrisiko prophylaktisch mitbehandelt werden. Allerdings lassen sich einmal zusammengebrochene Wirbelkörper mit dieser Methode nicht mehr in die ursprüngliche Form aufrichten. Ein weiteres Zusammensintern wird jedoch effektiv verhindert.
Zu beachten ist bei der Injektion, dass der Zement nicht in die abführenden Venen fließt, insbesondere wenn er zu flüssig ist, weil es sonst zu einer Lungenembolie kommen könnte, und dass kein Austritt in die rückenmarksnahen Räume stattfindet. Der zähflüssige Knochenzement wird am Operationstisch angerührt und ist mit einem Kontrastmittel, teilweise auch mit einem Antibiotikum versetzt. Diese Zusätze erhöhen die Sicherheit und die Sichtbarkeit im digitalen Röntgengerät während der Injektion.
Die verwendeten Bohrnadeln sind in verschiedenen Stärken und Längen verfügbar (z.B. OptiMed). Der Zement kann mittels spezieller Zementpistolen dosiert und mit gleichmäßigem Druckverlauf kontrolliert injiziert werden. Technische Probleme können dann auftreten, wenn eine starke Krümmung der Wirbelsäule (Skoliose) vorliegt, der Wirbel bei alten Frakturen sehr stark sklerosiert ist oder wenn die Bogenwurzeln im Durchleuchtungsbild schlecht erkennbar und abgrenzbar sind. Ansonsten ist die Bohrung in der Hand des erfahrenen Arztes sicher und komplikationsarm durchführbar.
Mögliche Komplikationen sind – wie schon erwähnt – die Verschleppung von Zement in die Blutgefäße sowie die Verletzung von Nervenstrukturen. Beides ist bei sorgfältiger Operationsplanung extrem selten und fast immer vermeidbar. Die Rate an permanenten Komplikationen liegt nach aktuellen Literaturdaten bei weniger als einem Prozent.
Der Eingriff lässt sich – je nach Anzahl der zu behandelnden Wirbelkörper – in 30 bis 60 Minuten durchführen und ist für den Patienten weitgehend schmerzfrei und – abgesehen von der etwas unbequemen Bauchlagerung – komfortabel und unter ambulanten Verhältnissen durchführbar. Nach wenigen Stunden der Überwachung gehen die Patienten selbstständig wieder nach Hause. Das Risiko einer Nachblutung ist bei den sehr kleinen Wunden gering und kann durch Kompression noch gesenkt werden, wenn sich die Patienten einige weitere Stunden auf den Rücken legen. Eine Nachbehandlung – sieht man von der Entfernung des Nahtmaterials nach zehn bis zwölf Tagen und der medikamentösen Osteoporosetherapie ab – ist nicht mehr notwendig.
Die Erfolgsrate, das heißt die Schmerzreduktion oder komplette Schmerzfreiheit und die Stabilisierung der betroffenen Wirbel, liegt laut Literatur bei etwa 80 Prozent. Bei Plasmozytompatienten ist es meist möglich, die Schmerzmedikation, selbst Morphine, stark zu reduzieren oder ganz abzusetzen. Fasst man dies zusammen, so ist die perkutane Vertebroplastie eine exzellente Methode zur minimal-invasiven und effektiven Behandlung des Rückenschmerzes durch Injektion eines gut verträglichen Knochenzementes in die Wirbelkörper. Bei unseren Patienten haben wir die gleichen positiven Erfahrungen machen können wie sie in der Literatur publiziert sind: Die Patienten können durch die transkutane Vertebroplastie sehr rasch und dauerhaft schmerzfrei werden.
aus ORTHOpress 2 | 2002
Alle Beiträge dienen lediglich der Information und ersetzen keinesfalls die Inanspruchnahme eines Arztes*in. Falls nicht anders angegeben, spiegeln sie den Stand zur Zeit der Erstveröffentlichung wider. Die aktuelle Einschätzung des Sachverhalts kann durch Erfahrungszuwachs, allgemeinen Fortschritt und zwischenzeitlich gewonnene Erkenntnisse abweichen.