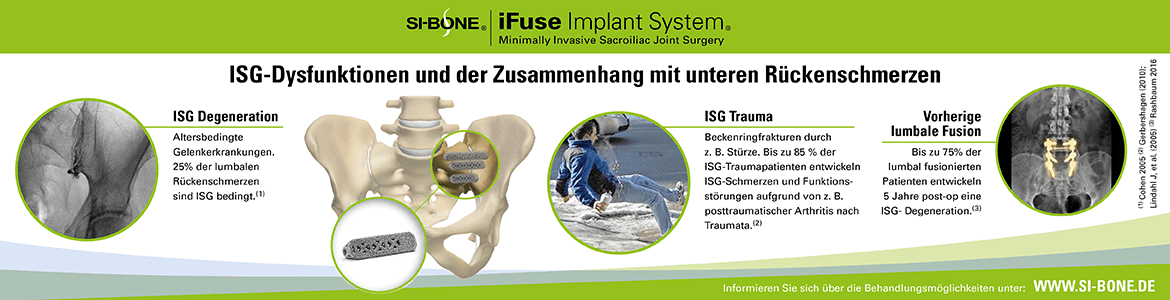Inhaltsverzeichnis
In vielen Fällen haben Rückenschmerzen ihre Ursache nicht in einer ernsthaften Erkrankung wie zum Beispiel einem schweren Bandscheibenvorfall. Stattdessen steckt hinter den Beschwerden oft ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Komponenten körperlicher, psychischer und sozialer Art.
Wenn Druck und Stress im familiären und beruflichen Alltag immer mehr zunehmen, kann dies zu immensen Belastungen führen, denen zahlreiche Menschen kaum noch gewachsen sind. Haushalt, Kindererziehung und selbst die Freizeitgestaltung – die Ansprüche an den Einzelnen werden ständig größer und lassen sich, so sehr sich dieser auch abmühen mag, oft kaum noch erfüllen. Verwundern kann es daher nicht, dass Körper und Seele irgendwann nicht mehr mitspielen. In den letzten Jahren haben Corona-Pandemie und Hochwasserkatastrophen dazu beigetragen, das Gefühl der Unsicherheit weiter zu verstärken. Darüber hinaus beeinträchtigen Existenzängste und soziale Konflikte unser Wohlbefinden. Kommt Bewegungsmangel hinzu, wie er durch die verschiedenen Lockdowns der Pandemiezeit begünstigt wurde, verstärken sich die gesundheitlichen Schäden, was sich in zahlreichen Fällen besonders auf den Rücken auswirkt.
Die eigentliche Schmerzursache wird oft verfehlt
Menschen, die unter chronischen Rückenbeschwerden leiden, wenden sich in der Regel an einen Arzt. Dieser ist in der Lage, mithilfe unterschiedlicher körperlicher Tests ernsthafte Erkrankungen wie Nervenschäden oder andere Verletzungen an der Wirbelsäule auszuschießen. Bei Bedarf werden darüber hinaus bildgebende Verfahren eingesetzt. Das Problem besteht jedoch darin, dass Röntgen- oder MRT-Aufnahmen oft Veränderungen wie Verschleißerscheinungen an der Wirbelsäule anzeigen, ohne dass diese jedoch die Ursache für die Schmerzen sein müssen. Eine Therapie, die auf einer solchen Diagnose aufbaut, hätte daher überhaupt keinen Sinn und würde das Problem eher verschleiern. Auf der anderen Seite sollte der Arzt natürlich auch keine Symptome übersehen. Es ist daher auf jeden Fall sinnvoll, auch die Lebensumstände und die Verfassung des Patienten in die Diagnostik mit einzubeziehen und nur bei Bedarf eine Röntgen- oder MRT-Untersuchung sowie weitere Untersuchungen und entsprechende Behandlungen durchzuführen.
Zusammenspiel körperlicher, psychischer und sozialer Faktoren
Vielfach spielen bei der Entstehung von Rückenschmerzen und anderen teilweise chronischen Beschwerden sowohl körperliche als auch seelische und soziale Faktoren eine maßgebliche Rolle. Oft bedingen sie sich auch gegenseitig. Ein solches Zusammenspiel wird von Wissenschaftlern als psychosoziales Schmerzmodell bezeichnet. Es handelt sich dabei um ein Modell, in dem körperliche Ursachen, psychische Stabilität und das soziale Umfeld des Patienten miteinander in Bezug stehen. Wenn Probleme seelischer und sozialer Art die Ursache von Rückenschmerzen sind oder diese verstärken, spricht man von psychosomatischen Rückenschmerzen.
Als Beispiel sei der Fall eines Mannes angeführt, der den ganzen Tag vor dem Computer sitzt, kaum körperlichen Ausgleich findet und mit der Zeit unweigerlich unter Verspannungen im Rücken und Nacken leidet. Kommen Stress und Druck durch den Arbeitgeber hinzu, so führt dies dazu, dass sich die Muskeln noch weiter verkrampfen. Aufgrund der inneren Anspannung neigt der Mann dazu, seine Schultern ständig hochzuziehen und seine Zähne zusammenzubeißen. Irgendwann treten dann die ersten Nacken- und Rückenschmerzen auf. Wenn auch privat keine Erholung oder Bewegung möglich ist, verstärken sich die Schmerzen. In der Folge werden Sport und Bewegung noch mehr als sonst gemieden und die Stimmung wird zunehmend gedrückter. Zudem fallen soziale Kontakte und andere Unternehmungen, die ohnehin schon stark eingeschränkt waren, noch öfter aus. So fokussiert sich der Betroffene immer stärker auf seine Schmerzen. Als erschwerend kann es sich erweisen, wenn Unverständnis von außen und Probleme mit dem Partner oder der Familie hinzukommen. Fehlt ein stabiles familiäres beziehungsweise soziales Umfeld, entsteht leicht eine Spirale aus Rückenschmerzen, sozialem Rückzug, Bewegungsmangel und weiteren Schmerzen. Im allerschlimmsten Fall drohen Arbeitslosigkeit und existenzielle Sorgen.
Hilfreich ist eine multimodale Therapie
Ein sinnvoller Weg, um diesen verhängnisvollen Kreislauf zu durchbrechen und der Abwärtsspirale zu entkommen, ist bei psychosomatischen Rückenschmerzen eine sogenannte multimodale Therapie. Diese beinhaltet neben einer vorübergehenden Einnahme von Schmerzmitteln vor allem Entspannungsübungen und eine schrittweise Veränderung der Lebensweise. Durch mehr Bewegung in der freien Natur und Strategien zur Stressbewältigung lassen sich die körperliche Anspannung und somit auch die Rückenschmerzen schrittweise lösen. Falls diese Maßnahmen nicht ausreichen, kann eine Therapie bei einem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie bzw. Psychosomatik hilfreich sein. Ziel der Therapie ist es, zu erlernen, wie physische und psychische Beschwerden miteinander zusammenhängen und wie man die Schmerzen in den Griff bekommen kann.
von Friederike Dorfländer
Psychosomatische Beschwerden ernst nehmen!
Allzu oft werden Menschen mit psychosomatischen Beschwerden immer noch als Simulanten bezeichnet. Dabei macht man sich nicht klar, dass die Betroffenen tatsächlich unter Schmerzen leiden. Es ist daher wichtig, dass sie von Ärzten und ihrem Umfeld ernst genommen werden. Genauso wichtig ist es jedoch, dass sie sich selbst eingestehen, dass sie etwas in ihrem Leben verändern müssen, um der Schmerzen Herr zu werden.