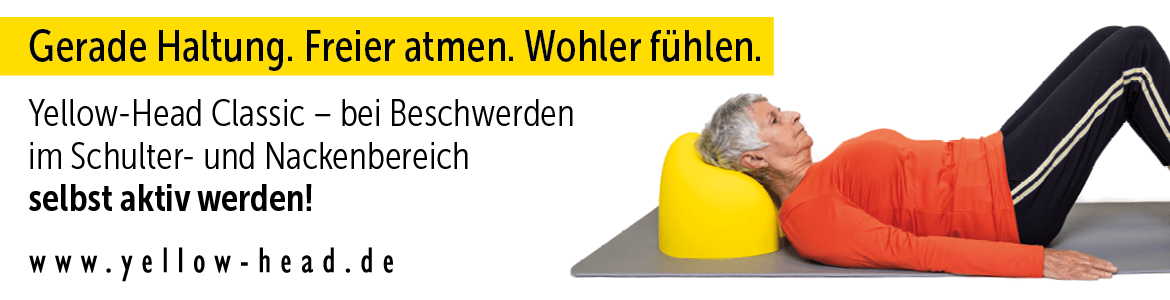Inhaltsverzeichnis
Wenn Schmerzen an der Unterseite des Fußes auftreten, kann dies auf eine Reizung der dort befindlichen flächigen Sehnenplatte zurückzuführen sein. In der Medizin wird dieses Krankheitsbild, das den Alltag der Betroffenen oft erheblich einschränkt, als Plantarfasziitis bezeichnet. Durch konservative Maßnahmen ist die Erkrankung in der Regel gut zu behandeln, wobei vor allem regelmäßig durchgeführte Dehnübungen eine wichtige Rolle spielen.
Die Beschwerden, die in Verbindung mit einer Plantarfasziitis entstehen, machen sich besonders dann bemerkbar, wenn man morgens zum ersten Mal auftritt. Je nach Schweregrad oder Krankheitsstadium können sie mit Unterbrechungen oder dauerhaft bestehen. Manchmal nehmen die Betroffenen eine ungesunde Schonhaltung ein, indem sie etwa den Fuß nicht mehr richtig abrollen und in einer Spitzfußstellung gehen. Auch wenn die Erkrankung generell altersunabhängig ist, ist eine Häufung bei Erwachsenen ab dem 40. Lebensjahr zu beobachten. Dabei spielt vermutlich Verschleiß eine Rolle. Manchmal treten die reizbedingten Schmerzen an beiden Füßen gleichzeitig auf.
Der Reizzustand, welcher sich vor allem am Übergangsgebiet der Sehne zeigt, hat seine Ursache in einer Fehl- oder Überbelastung der Plantarfaszie, die flächig unter dem Fuß entlangläuft. Häufig kommt es dazu beim Sport, typischerweise bei Läufern und Schwimmern, oder wenn Fußfehlstellungen wie Plattfüße vorliegen. Auch Beinfehlstellungen können ein Grund für eine übermäßige Belastung der Plantarfaszie sein. Zu den weiteren Risikofaktoren zählen Verkürzungen der Wadenmuskulatur oder der Achillessehne, Übergewicht und schlechtes Schuhwerk. Wenn es zu einem Unfall kommt, können kleinste Verletzungen des Gewebes an der Fußsohle zu Entzündungen und somit zu einer Plantarfasziitis führen.
Ein Fersensporn kann, muss aber nicht begleitend auftreten
Eine Plantarfasziitis kann mit einer punktuellen Verkalkung an der Sehne, einem sogenannten Fersensporn, einhergehen. Dieser wird dann oft fälschlicherweise für die Beschwerden verantwortlich gemacht. In Wahrheit ist er jedoch „nur“ eine zusätzliche Schmerzursache und nicht die Ursache, sondern lediglich eine Folge der Plantarfasziitis. Während ein Sporn bei vielen Betroffenen gar nicht auftritt, wird bei anderen im Röntgenbild ein unterer Fersensporn manchmal als Zufallsbefund entdeckt, ohne dass sie ihn spüren würden. Eine Plantarfasziitis kann also, muss aber nicht zu einem Fersensporn führen, und auch dann, wenn er auftritt, muss er nicht mit Schmerzen verbunden sein.
Zu vermeiden ist eine Chronifizierung der Schmerzen
Die Diagnose einer Plantarfasziitis lässt sich anhand der Beschreibung der Beschwerden sowie von Funktionstests und der Palpation durch den Arzt erstellen. Hinzu kommt die Auswertung bildgebender Untersuchungen. Mithilfe der Sonografie (Ultraschall) können vor allem Weichteile wie Sehnen und ihre Veränderungen beurteilt werden. Röntgenbilder im Stand und/oder unter Belastung können dabei helfen, die Beinachsen zu bestimmen und so eventuell auslösende Faktoren ausfindig zu machen.
Wichtig ist eine frühzeitige Therapie, um zu vermeiden, dass die Fußschmerzen chronisch werden. Die Plantarfasziitis ist vor allem eine Domäne konservativer Therapieformen. Nur in Ausnahmefällen ist ein chirurgischer Eingriff nötig, z. B. um eine Denervierung und Einkerbung des Sehnenansatzes zur Spannungsminderung durchzuführen. Meist jedoch sind nicht-operative Verfahren erfolgversprechend. Dazu gehören unter anderem weichbettende Schuhzurichtungen, Stoßwellentherapie, Röntgenreizbestrahlung, entzündungslindernde Medikamente und Physiotherapie. Kortison-Injektionen in die Fußsohle können zwar akute Schmerz- und Entzündungszustände lindern, sollten aber nur in Ausnahmefällen und keineswegs mehrfach hinterei-nander angewendet werden.
Wichtig ist eine gut gedehnte Fußmuskulatur
Begleitend zu allen Behandlungsverfahren ist es wichtig, regelmäßige Dehnungsübungen durchzuführen. Idealerweise sollte das sogenannte exzentrische Dehnen mehrmals täglich wiederholt werden. Der Ablauf ist z. B. folgender: Beim Stehen auf einer Treppe befinden sich beide Fußballen auf einer Stufe, während die Fersen in der Luft hängen. Indem der Fuß gehoben und abgesenkt wird, wird er gekräftigt und gedehnt.
Sport dagegen sollte während der akuten Erkrankung nur maßvoll und nach Absprache mit dem Arzt durchgeführt werden. Vor allem die belastenden Bewegungen, die unter Umständen zur Entstehung der Plantarfasziitis beigetragen haben, müssen vermieden und später dann wieder möglichst schonend eingeübt werden.
Da sich mit einer starken und zugleich gut gedehnten Fußmuskulatur einer Erkrankung wie der Plantarfasziitis vorbeugen lässt, sollten die Dehnübungen auch nach Abklingen der Beschwerden beziehungsweise präventiv durchgeführt werden. Auch Barfußlaufen bringt einen positiven Effekt auf die Weichteile des Fußes mit sich. Außerdem ist es ratsam, den Ursachen für die Sehnenplattenreizung nach Möglichkeit entgegenzuwirken, z. B., indem man die Füße bei Fehlstellungen mit Schuheinlagen entlastet, Übergewicht reduziert oder die Technik beim Sport durch ein gezieltes Lauftraining verbessert.
von Klaus Bingler