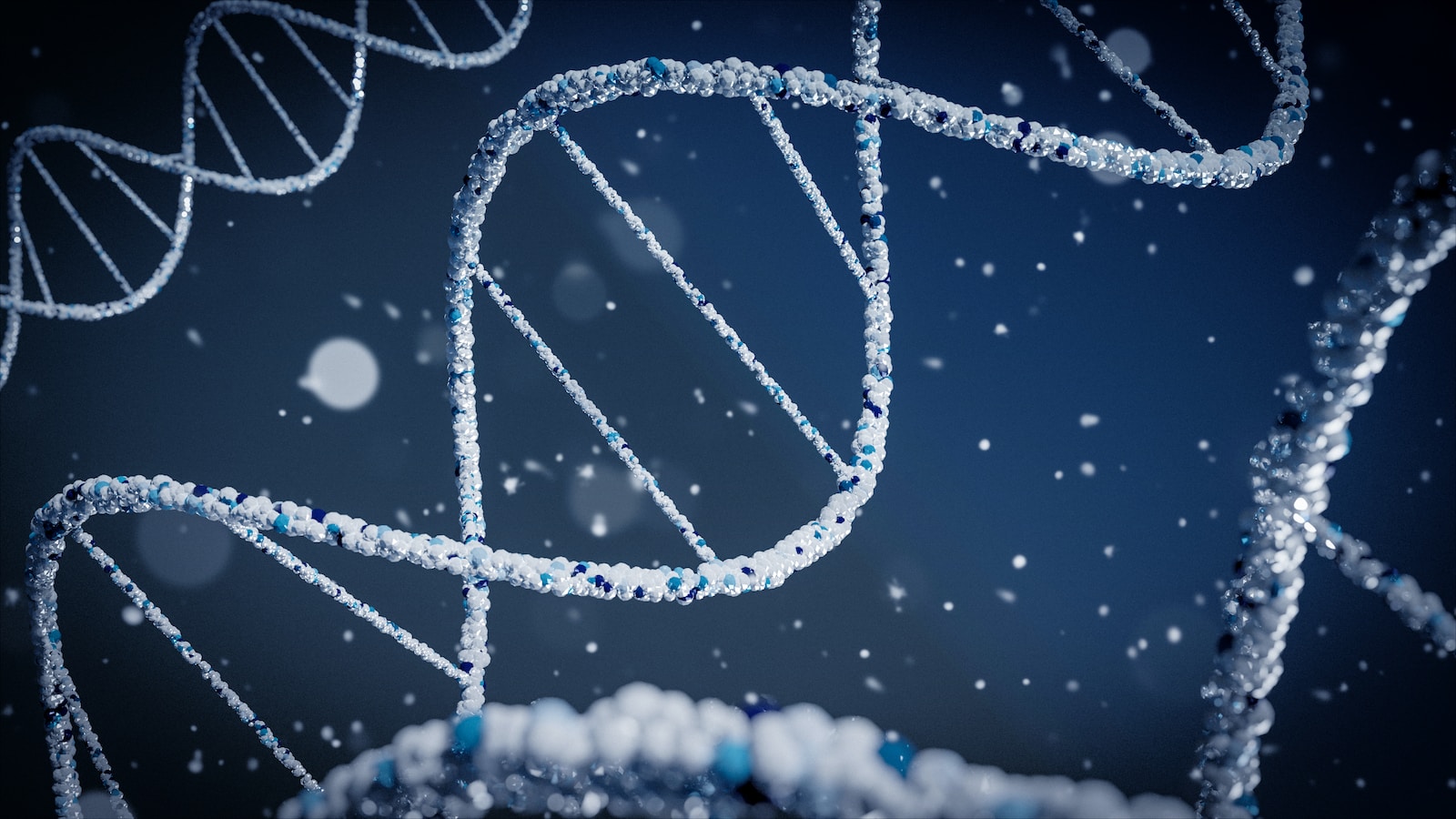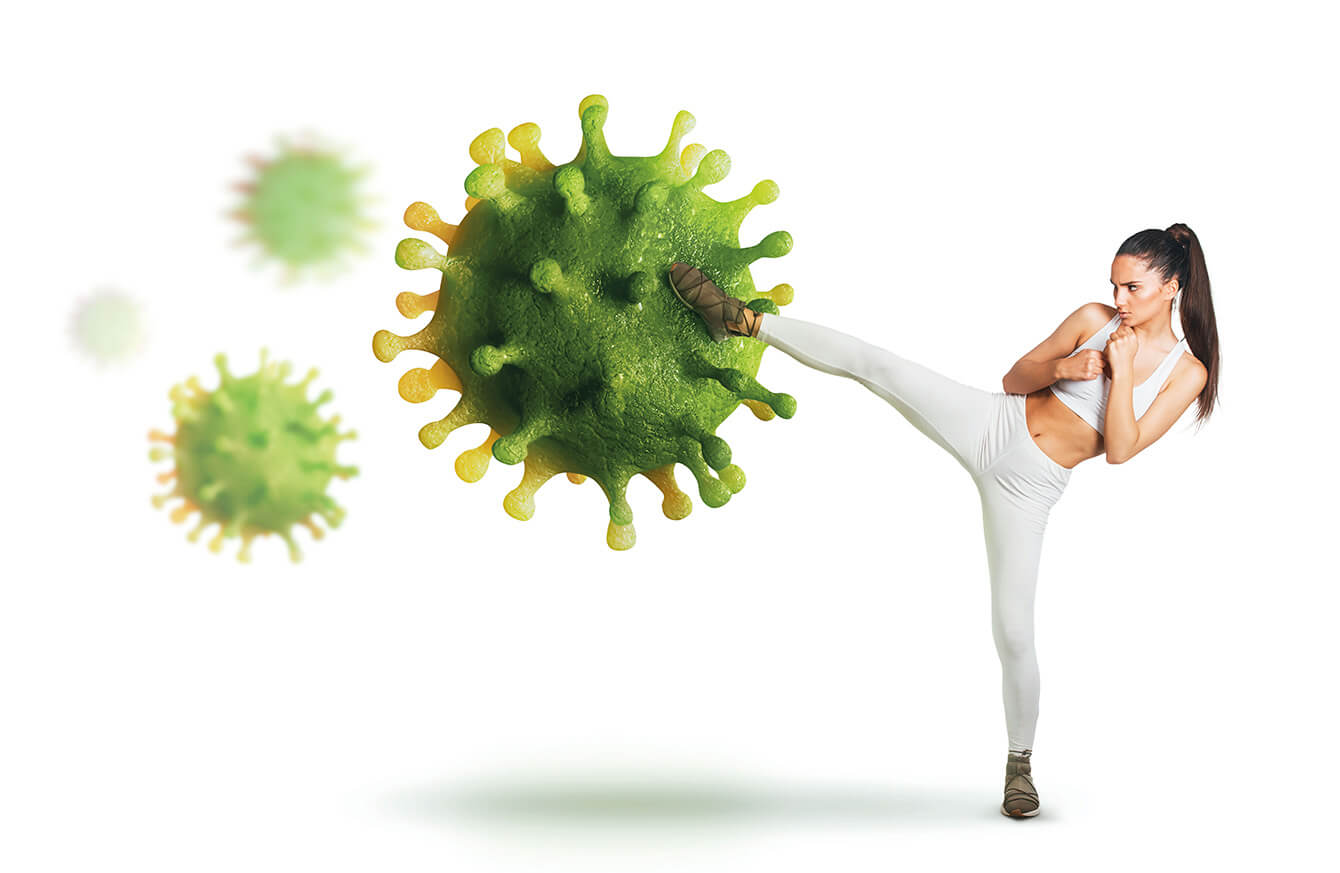
Inhaltsverzeichnis
Das menschliche Immunsystem und seine Funktionsweise
Unser Immunsystem schützt uns vor Gegnern und Feinden unterschiedlichster Art. Verteilt über den gesamten Körper, gliedert es sich in eine unspezifische, angeborene Abwehr und ein spezifisches, erworbenes Abwehrsystem. Unterstützt werden beide Systeme von zahlreichen Helfern.
Als erste Barriere fungieren bereits die Haut und die Schleimhäute an den Körperöffnungen. Sie sorgen auf rein mechanische Art sowie durch ein bestimmtes körpereigenes Bakterienmilieu dafür, dass möglichst wenige Fremdstoffe ins Körperinnere gelangen. Lässt sich ein Eindringen nicht verhindern, werden Mechanismen in der Nase und den Bronchien wirksam, um die Fremdstoffe wieder loszuwerden. Dies geschieht zum Beispiel durch Niesen oder Husten. Außerdem sind in Speichel und Tränenflüssigkeit Enzyme enthalten, die in der Lage sind, bestimmte Bakterien abzutöten. Darüber hinaus vernichtet die Magensäure beim Verschlucken zahlreiche Fremdkörper. All diese Maßnahmen verhelfen uns zu einem relativ guten Schutz gegen „normale“ schädliche Umwelteinflüsse.
Angeborene, unspezifische Abwehr
Ein schwerwiegenderes Problem stellen Krankheitserreger dar, die es trotz dieser Schutzmaßnahmen ins Innere unseres Körpers schaffen und dort Schaden anrichten können. In solchen Fällen wird die sogenannte zelluläre unspezifische Immunabwehr aktiv. Zu ihr zählen Fresszellen (Monozyten und Makrophagen), Mastzellen, Granulozyten und natürliche Killerzellen. Dieses Abwehrsystem kann verschiedene krank machende Mikroorganismen anlocken und zum Teil auch vernichten. Letzteres geschieht zum Beispiel dadurch, dass Krankheitserreger im Inneren der Fresszellen eingeschlossen und anschließend verdaut werden. Zu den Aufgaben der natürlichen Killerzellen gehört es, Tumorzellen und mit Viren infizierte Zellen zu erkennen und zu eliminieren. Unterstützt wird die zelluläre Immunabwehr durch bestimmte im Blut zirkulierende Proteine. Diese markieren unerwünschte Eindringlinge, sodass sie von Fresszellen besser erkannt und vernichtet werden können. Darüber hinaus regen sie bei Bedarf weitere Immunreaktionen an. Andere Proteine sind in der Lage, sich auf der Oberfläche der Erreger festzukrallen und sie miteinander zu verbinden und zu verklumpen.
Zusammenarbeit mit dem spezifischen Immunsystem
Zwischen unspezifischem und spezifischem Immunsystem besteht eine enge Zusammenarbeit. Die spezifische Abwehr entwickelt sich erst im Laufe der Zeit durch Kontakt mit unterschiedlichen Krankheitserregern. Akteure dieser erworbenen Abwehr sind die T- und B-Lymphozyten. Zu Beginn einer Infektion wird zunächst das gesamte Programm der unspezifischen Abwehr durchgespielt. Wenn es dem Körper auf diese Weise nicht gelingt, die Erreger erfolgreich zu bekämpfen, kommt nach einiger Zeit das spezifische Immunsystem zum Einsatz. Dabei spielen spezielle Strukturen, die sich auf der Oberfläche von Erregern wie zum Beispiel Bakterien befinden, eine wichtige Rolle. Diese sogenannten Antigene sind von Erreger zu Erreger unterschiedlich. Einige Zellen wie Makrophagen oder B-Lymphozyten können sie den T-Lymphozyten als Fremdkörper präsentieren. Sobald ein T-Lymphozyt ein Antigen als Eindringling identifiziert, wird eine komplexe Immunreaktion ausgelöst. Dabei werden unter anderem weitere B-Lymphozyten aktiviert, die sich in Plasmazellen umwandeln. Diese produzieren sogenannte Antikörper, welche an die Antigene andocken und die Krankheitserreger somit für die Zerstörung kenntlich machen. Zwischen Antikörper und Antigen besteht ein Verhältnis, das auf dem Schlüssel-Schloss-Prinzip basiert. Dementsprechend verbindet sich nur der passende Antikörper mit dem entsprechenden Antigen. Auf diese Weise werden die Keime unschädlich gemacht und für das Immunsystem markiert, sodass sie von den Fresszellen erkannt und beseitigt werden können.
Wenn das Immunsystem mit neuen Antigenen in Kontakt kommt, dauert es zunächst eine gewisse Zeit, bis sich die dazu passenden Antikörper gebildet haben. Allerdings ist das erworbene, spezifische Immunsystem in der Lage, eine Art Gedächtnis auszubilden. So kann es sich einige Antigene wie beispielsweise Mumpsviren ein Leben lang „merken“ und sie bei einem erneuten Kontakt sofort ausschalten. Daher sind wir nach einer überstandenen Mumpserkrankung in der Regel zeit unseres Lebens gegen Mumpsviren immun. Gleiches gilt für Masern und Röteln.
Die Aufgaben der lymphatischen Organe
Ein wichtiger Bestandteil des Immunsystems sind die Organe, in denen die Abwehrzellen, die Lymphozyten, gebildet werden. Als primäre lymphatische Organe gelten das Knochenmark und die Thymusdrüse, ein Organ oberhalb des Herzens. Das Knochenmark ist ein spezielles Gewebe im Inneren des Knochens, in welchem die Lymphozyten aus einer gemeinsamen „Mutterzelle“ oder Stammzelle entstehen. Die B-Lymphozyten reifen bereits im Knochenmark heran und wandern danach ins Blut und in die lymphatischen Gewebe. Von dort wandert ein Teil von ihnen in die Thymusdrüse und reift dort zu T-Lymphozyten heran. Die Thymusdrüse wird nach der Pubertät allmählich in Fettgewebe umgewandelt.
Zu den sekundären lymphatischen Organen, in denen die Erreger bekämpft werden, zählen neben Lymphknoten und Lymphbahnen auch Milz, Mandeln (Tonsillen), Blinddarm sowie die sogenannten Peyer-Plaques in der Dünndarmschleimhaut.
Das Lymphsystem lässt sich mit einem System aus Wasserkanälen vergleichen, in das zahlreiche Kläranlagen in Form von Lymphknoten zwischengeschaltet sind. Überschüssige Gewebeflüssigkeit und Stoffwechselprodukte werden über die Lymphbahnen abgeleitet. In den Lymphknoten filtern Makrophagen und Lymphknoten Krankheitserreger und Tumorzellen aus der Lymphflüssigkeit heraus, um sie zu vernichten. Aus diesem Grund sind die Lymphknoten im Krankheitsfall besonders aktiv und schwellen manchmal an.
Mit Immuntherapien gegen Krebs
Krebszellen verfolgen die Strategie, sich vor unserem Immunsystem zu verstecken und es auszubremsen. Im Gegenzug suchen Forscher seit einiger Zeit nach Wegen, ihrerseits die Tumorzellen auszutricksen und das Immunsystem dazu zu bewegen, sie gezielt auszubremsen und zu vernichten. Zu den Ansätzen, die dabei verfolgt werden, gehören:
Die Antikörpertherapie bei Lymphdrüsenkrebs: eine der ältesten erfolgreichen Immuntherapien. Den Patienten werden spezielle Antikörper verabreicht, die genau zu den Antikörpern auf den Oberflächen der bösartigen Lymphomzellen passen. Indem sie an den Lymphomzellen andocken, aktivieren sie die Zerstörung der Tumorzellen. Ähnliche Verfahren gibt es inzwischen auch für Brust- und Dickdarmkrebs.
Die sogenannten Immun-Checkpoints. Dabei handelt es sich um Rezeptoren auf der Membran von T-Lymphozyten, die dazu dienen, das Immunsystem zu kontrollieren. So verhindert man, dass es zu einer überschießenden Immunreaktion kommt und das Immunsystem sich gegen sich selbst richtet. Fatalerweise sind auch Tumorzellen dazu in der Lage, diese Immun-Checkpoints zu aktivieren und dadurch die Immunabwehr so zu schwächen, dass sie fast ungebremst weiterwachsen können. Neue sogenannte Checkpoint-Inhibitoren zielen darauf ab, die Immunblockade zu lösen. So sollen sie dafür sorgen, dass das Immunsystem die Tumorzellen wieder als solche erkennt und bekämpfen kann. Erfolgreich zu sein scheint diese Behandlungsmethode bei bestimmten Krebsarten wie dem schwarzen Hautkrebs oder einigen Formen von Lungenkrebs. Leider ist die Therapie nicht bei allen Patienten wirksam, selbst wenn sie scheinbar von der gleichen Tumorart befallen sind. Aus diesem Grund versuchen Forscher herauszufinden, welche speziellen Merkmale die Tumorzellen besitzen müssen, damit die Therapie funktioniert und man ihre Chancen besser vorhersagen kann.
Die T-Zellen-Entnahme aus dem Blut der Patienten. Dabei sollen die isolierten T-Zellen so im Labor manipuliert werden, dass sie die Tumorzellen erkennen und bekämpfen können. Danach werden sie dem Patienten wieder injiziert. Man bezeichnet diese Therapiemethode, die noch in den Kinderschuhen steckt, zuweilen auch als therapeutische Impfung.
Nebenwirkungen und Kosten
Eine Immuntherapie kann mit teilweise erheblichen Nebenwirkungen verbunden sein. So ist es nach der Verabreichung von Checkpoint-Inhibitoren möglich, dass das dadurch praktisch enthemmte Immunsystem deutlich überreagiert und heftige Autoimmunreaktionen entstehen. Zudem kosten diese Behandlungen um die 100.000 Euro pro Patient und werden von den Krankenkassen nur bedingt übernommen.
Viele Fragen zur Wirksamkeit der Therapie sind bislang noch offen. Daher werden einige Immuntherapien nur im Rahmen einer Studie oder bei austherapierten Patienten angewendet.
Wie wirkt eine Impfung?
Mit einer Impfung wird das gleiche Ziel verfolgt wie mit dem „Gedächtnis“ der spezifischen Immunabwehr. Dabei werden dem Körper ähnlich wie bei einer durchlebten Infektion die Antigene von Erregern zugeführt, allerdings in einer abgeschwächten, nicht krank machenden Version. Das Immunsystem wird so in die Lage versetzt, die entsprechenden Antikörper zu bilden. Bei einem echten Kontakt mit der eigentlichen Krankheit kann es daher umgehend reagieren und den Ausbruch im günstigen Fall verhindern oder den Krankheitsverlauf zumindest abmildern.
von Rita Lütze-Brandner