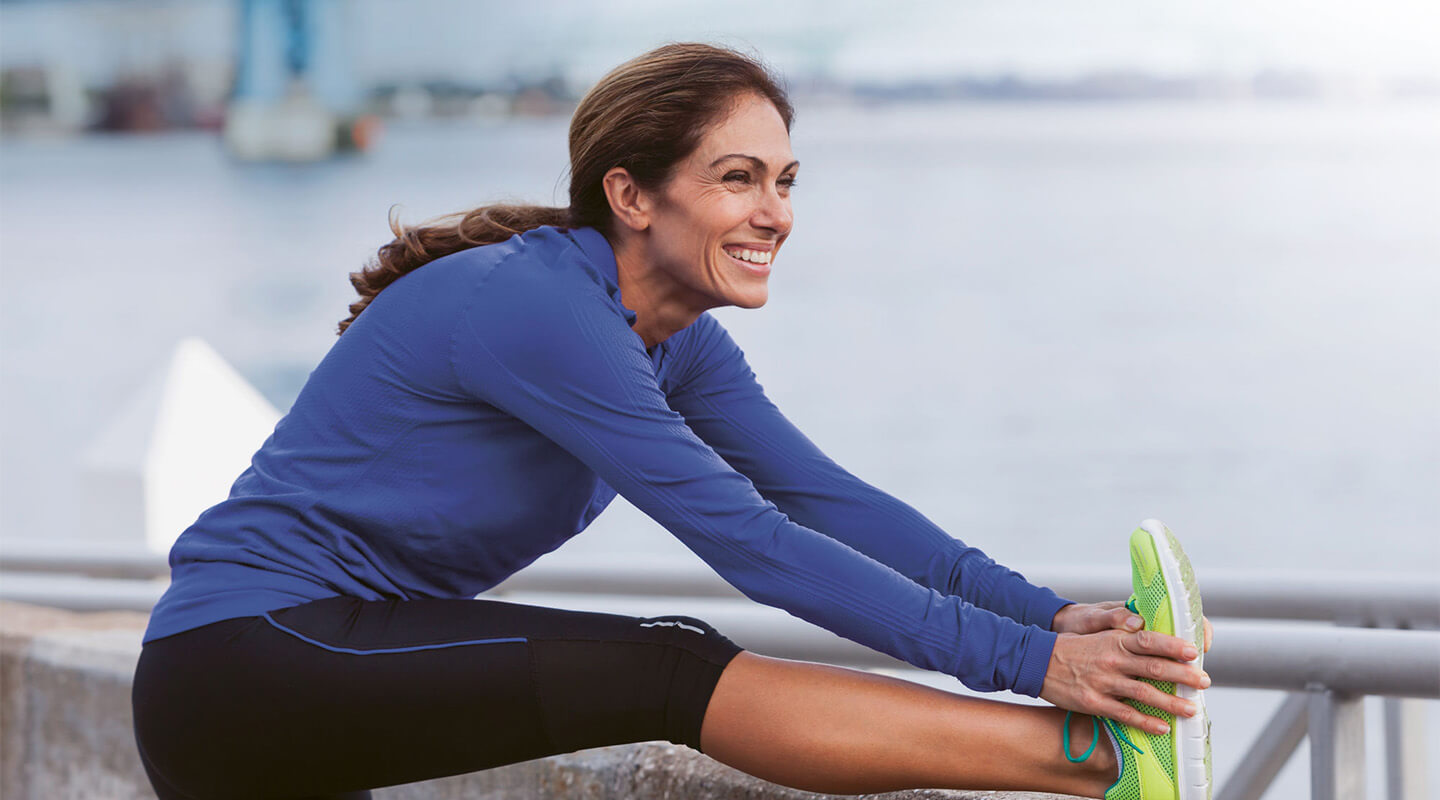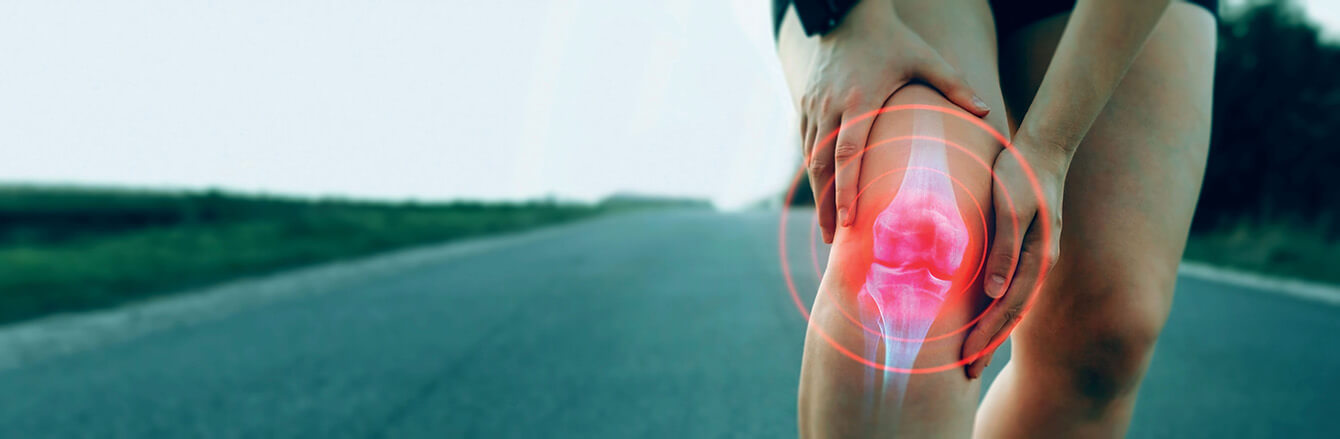Dass wir unsere Arme in alle Richtungen bewegen können, ohne dass der Oberarmkopf ständig auskugeln würde, verdanken wir der Rotatorenmanschette. Es handelt sich dabei um eine Muskel- und Sehnengruppe, die das Schultergelenk, dem eine knöcherne Führung weitgehend fehlt, regelrecht umklammert. Sie verschafft uns somit sowohl Beweglichkeit als auch Halt.
Die Rotatorenmanschette besteht aus vier Muskeln samt zugehörigen Sehnen und wird vom flächigen Deltamuskel bedeckt. Im Laufe des Lebens kann sie vielfältigen Belastungen ausgesetzt sein. Betroffen sind davon vor allem Menschen, die berufsbedingt oder im Rahmen des Sports viele Überkopfbewegungen ausführen. Ein Anzeichen für kleine Schädigungen oder gar einen Riss der Rotatorenmanschette kann zum Beispiel dann vorliegen, wenn die Betroffenen nicht mehr in der Lage sind, die Arme weit über den Kopf anzuheben, oder ihnen sogar das Kämmen der Haare schwerfällt.
Risse der Rotatorenmanschette gehen häufig mit Verschleiß einher
Belastungen der Rotatorenmanschette können zu degenerativen Veränderungen wie Mikroverletzungen in Muskeln und Sehnen oder Entzündungen des Gewebes führen. Unter diesen Umständen ist es möglich, dass bei einer Überlastung, etwa durch einen Sturz auf die Schulter oder den Arm, die Rotatorenmanschette vollständig oder teilweise reißt. Ist die Vorschädigung sehr stark, kann auch ein relativ geringes Unfallgeschehen dafür ausreichen. In den meisten Fällen treten die Rissstellen an den weniger durchbluteten Ansätzen der Muskeln und den gespannten Sehnen auf. Am häufigsten ist die sogenannte Supraspinatussehne, welche von oben den Oberarmkopf umschließt und beim Heben des Armes vom Schulterdach eingeengt wird, von einer Überbelastung betroffen und kann geschädigt werden und reißen. Dies ist besonders dann der Fall, wenn eine Schulterenge, ein sogenanntes Impingement, vorliegt.
Reißt ein Muskel an der Schulter komplett ab, besteht die Gefahr, dass sich die Sehne innerhalb weniger Wochen zurückzieht und die Muskulatur verfettet. Daher sind ältere Risse der Rotatorenmanschette häufig schwer zu behandeln. Zudem können sie zu Dezentrierungen des Gelenkkopfes führen – eine mögliche Ursache für eine Arthrose. Im Übrigen verstärkt jede Schädigung der Rotatorenmanschette das Risiko für eine Schultergelenkarthrose, da sie eine Instabilität und damit eine größere Reibung der Gelenkflächen zur Folge haben kann.
Nur in selteneren Fällen kommt es bei jüngeren Menschen ohne nennenswerte Vorschädigungen zu Rissen der Rotatorenmanschette. Dann geschieht dies in aller Regel im Zusammenhang mit einem schweren Unfall, einhergehend mit einer erhöhten Krafteinwirkung. Zugleich kommt es dabei häufig auch zu Absprengungen knöcherner Anteile oder anderen Verletzungen, zum Beispiel an der Gelenkpfannenlippe, einer sogenannten SLAP-Läsion.
Konservative und operative Therapieverfahren
Um Folgeschäden zu vermeiden, sollte jeder Rotatorenmanschettenriss frühzeitig behandelt werden. Dies gilt sowohl für verschleißbedingte als auch traumatische Rupturen. Vor der Entscheidung für eine Therapie sollte eine gründliche Diagnostik erfolgen. Dabei spielen nicht nur bildgebende Verfahren, sondern auch Funktionstests eine wichtige Rolle. Darüber hinaus kommt es auf das Alter des Patienten an sowie auf den Anspruch, der an die Funktionstüchtigkeit des Gelenks gestellt wird. Entscheidend ist auch die Frage, wie stark die muskuläre Dysbalance den Betroffenen im Alltag einschränkt.
Konservativ behandeln lässt sich ein Rotatorenmanschettenriss auf medikamentösem Wege in Tablettenform oder als Injektion. Daneben besitzt die Physiotherapie einen wichtigen Stellenwert. Es fallen darunter aktive, angeleitete Bewegungs- und Kräftigungsübungen sowie manuelle Behandlungsmethoden. Bevorzugen wird man eine konservative Therapie vor allem bei älteren Menschen mit zusätzlichen Begleiterkrankungen, um die mit einer Operation verbundenen Risiken nach Möglichkeit auszuschalten. Aber auch in vielen anderen Fällen führen nicht-operative Therapien zu guten Ergebnissen.
Eine Operation kommt immer dann infrage, wenn eine konservative Therapie von Beginn an nicht als Erfolg versprechend betrachtet werden kann oder wenn trotz konservativer Therapie starke Schmerzen verbleiben, die den Alltag einschränken. Ein solcher Eingriff lässt sich vielfach minimalinvasiv arthroskopisch durchführen. Auf diese Weise erhält man zudem ein Bild über das gesamte Ausmaß der Schädigung. Man arbeitet dabei mit einer Kamera, einem sogenannten Arthroskop, das über einen kleinen Schnitt eingebracht wird und dabei hilft, die speziellen Instrumente zu führen, mit denen eine Ruptur genäht oder eine gerissene Sehne wieder angebracht werden kann. Durchführen lässt sich eine solche Sehnenrekonstruktion auch mit einer speziellen Nahtankertechnik. Darüber hinaus bietet die Arthroskopie die Möglichkeit, Substanzen, welche die Anheilung unterstützen, wie zum Beispiel Wachstumsfaktoren, an die Sehne zu injizieren oder die Sehne durch einen Patch zu verstärken, wenn sie stark ausgedünnt ist. Im Rahmen desselben Eingriffs können auch begleitende Schäden behandelt werden, wie zum Beispiel Knochenabtragungen am Schulterdach.
Wenn eine Sehne sehr stark verletzt oder die Muskulatur der Rotatorenmanschette in erheblichem Maße beschädigt ist, kommt eine Naht oft nicht mehr infrage. In einem solchen Fall kann die Lösung darin bestehen, minimalinvasiv einen sogenannten InSpace-Ballon in die Schulter einzuführen, welcher als Platzhalter einem Hochstand des Oberarmkopfes entgegenwirkt und das Gelenk wieder in seine zentrale Stellung bringt. Der Ballon löst sich nach sechs bis zwölf Monaten von selbst wieder auf. In dieser Zeit sollte der Patient seine Muskulatur mithilfe von Krankengymnastik stärken, um die verletzungsbedingten Schäden zu kompensieren.
Handelt es sich um einen größeren und/oder älteren Defekt der Rotatorenmanschette und ist eine größere Sicht auf das Operationsgebiet erforderlich, kommt eine offene Operation infrage, bei der wie bei einem arthroskopischen Eingriff ebenfalls mit Nähten und Ankern gearbeitet wird. Falls die Schäden so groß sind, dass sie als irreparabel betrachtet werden müssen, und liegt gegebenenfalls eine begleitende Arthrose vor, kann der Einsatz einer Endoprothese in Erwägung gezogen werden. Meist wird dazu eine sogenannte inverse Schulterprothese verwendet, bei der die Positionen von Gelenkkopf und Gelenkpfanne vertauscht sind. Auf diese Weise kann die Schulter durch die Muskelkraft des Deltamuskels besser bewegt werden, ohne dass die Rotatorenmanschette intakt sein muss.
von Rita Lütze-Brandner