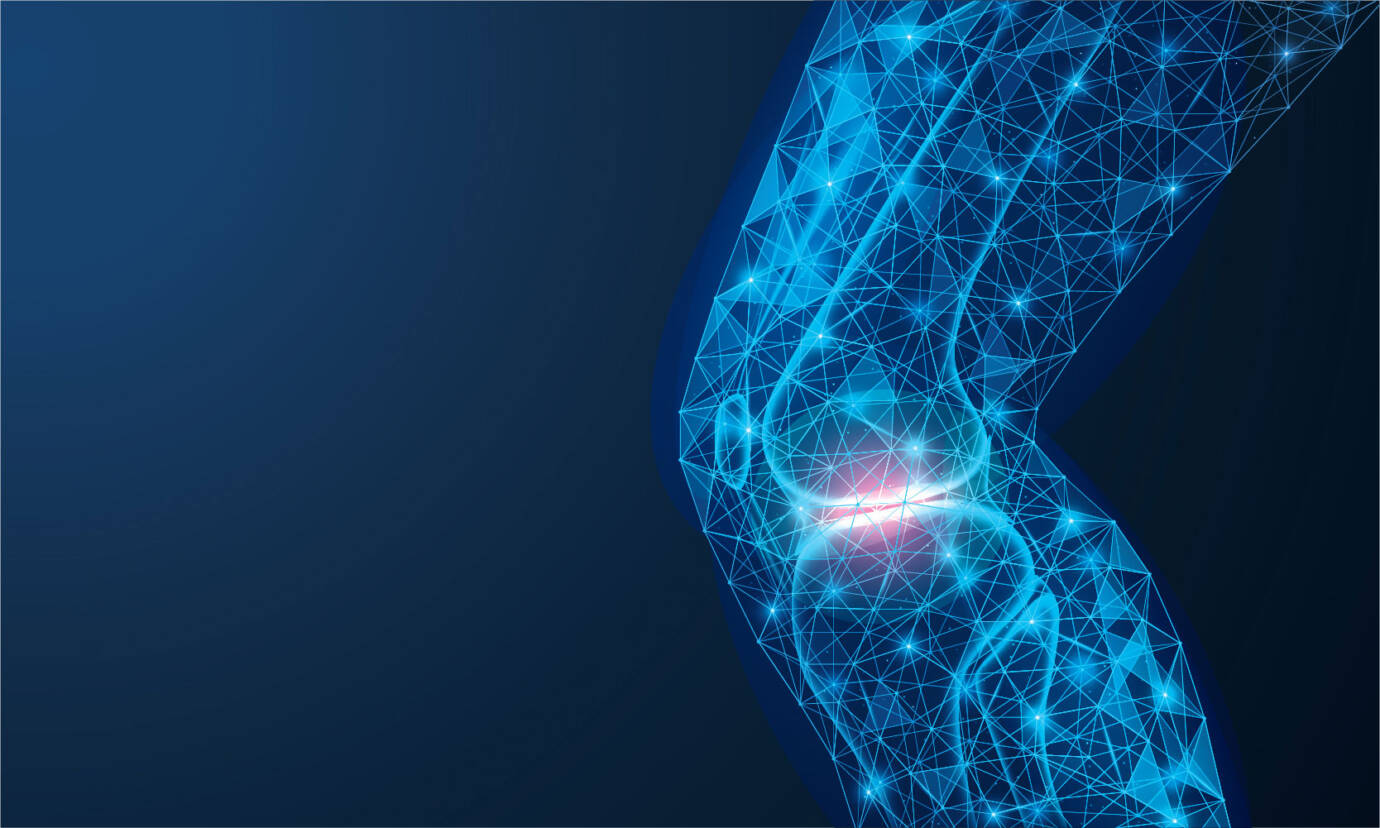
Inhaltsverzeichnis
Aufbau, Erkrankungen & Ersatztherapien
Knorpel gibt es an den unterschiedlichsten Stellen unseres Körpers, zum Beispiel in den Bandscheiben, den Menisken des Kniegelenks oder an Nase oder Ohrmuschel. Das Gewebe, aus dem er besteht, ist sowohl elastisch als auch druckstabil und daher gut geeignet als Puffer zwischen Gelenkpartnern.
Während der Wachstumsphase spielt Knorpel eine wichtige Rolle für die Knochenbildung. So besteht das Skelett eines Embryos zunächst aus Knorpelgewebe und verknöchert erst im Laufe der Zeit. Auch das Gewebe, das in den Wachstumsfugen gebildet wird, welche sich nach der Pubertät schließen, ist zu Beginn knorpeliger Natur, um erst später zu verknöchern. Dieser Vorgang wird auch als chondrale Osteogenese bezeichnet, wobei die Chondroklasten als Fresszellen die Knorpelzellen abbauen, während die Osteoblasten den Knochen aufbauen.
Die drei Haupttypen von Knorpelgewebe sind:
- Hyaliner Knorpel
Diese Knorpelart findet sich vor allem in den Gelenken, darüber hinaus auch in der Nase, den Rippen, der Luftröhre und den Wachstumsfugen bei Kindern. Ihre Dichte an Knorpelzellen ist relativ gering. Da hyaliner Knorpel sehr elastisch ist, ist er in der Lage, hohen Druckverhältnissen standzuhalten. Zugleich jedoch ist er häufigen Abnutzungsprozessen ausgesetzt. Die Ursache dafür liegt unter anderem an seiner geringen Regenerationsfähigkeit. Ungünstig können sich zudem Kalkablagerungen oder übermäßiger Druck auswirken. - Elastischer Knorpel
Dieser verfügt über eine höhere Zelldichte und ist aufgrund seiner elastischen Fasern recht biegsam und flexibel. Er ist hauptsächlicher Bestandteil der Ohrmuschel und kommt auch in der Kehle und den Bronchien vor. - Faserknorpel
(Bindegewebsknorpel)
Dabei handelt es sich um die zellärmste und widerstandsfähigste Knorpelart. Zum großen Teil aus Kollagen bestehend, kann sie Zugkräften besonders gut standhalten. Aus Faserknorpel bestehen sowohl der Faserring in den Bandscheiben als auch Menisken, Gelenklippen und Teile der Schambeinfuge. Einige Knorpelersatzverfahren, die bei verschlissenem Gelenkknorpel eingesetzt werden, zielen darauf ab, durch gewollte Verletzungen die Bildung von Faserknorpel anzuregen.
Knorpelerkrankungen
Ebenso wie es bei Knochen der Fall ist, kann auch Knorpelgewebe durch traumatische Ereignisse Schaden nehmen. So kann Knorpel ein-, aus- oder abreißen. Zudem können in Gelenken flächige Defekte entstehen, die zunächst noch klein sind, aber eine Schwachstelle bilden und daher durch Reibung immer größer werden. Zu den Knorpelerkrankungen gehören:
- Tietze-Syndrom
Dabei kommt es zu kleinen Knorpelbrüchen und knöchernen Verdickungen an den oberen Rippen. - Chondrokalzinose
Durch Kalkablagerungen im Gelenkknorpel kann dieser langfristig zerstört werden. - Polychondritis
Eine schubartige Entzündung des Knorpels, der auf diese Weise auch seine Festigkeit verliert. - Chondromalazie
Eine Erkrankung, bei welcher der Knorpel weicher wird und sich abbaut.
Darüber hinaus wird Knorpel auch durch die entzündlichen Prozesse beim Rheuma geschädigt. Die häufigste Erkrankung des Knorpels ist jedoch die Arthrose, der degenerative Gelenkverschleiß. Dabei kommt es zu einem vorzeitigen Knorpelabrieb, welcher durch eine mangelhafte Nährstoffversorgung und/ oder übermäßige Belastungen hervorgerufen werden kann.
Knorpelersatztherapien
Bei einer fortgeschrittenen Arthrose besteht häufig die Notwendigkeit, erkrankten Knorpel zu ersetzen. Bevor man sich zu einem solchen Schritt entschließt und zu diesem Zweck ein Kunstgelenk, eine sogenannte Endoprothese, einsetzt, besteht heutzutage in vielen Fällen die Option, Abhilfe mithilfe gelenkerhaltender Verfahren zu schaffen. Entsprechende Methoden lassen sich in der Regel auf minimalinvasive beziehungsweise arthroskopische Weise anwenden. Handelt es sich um einen umschriebenen Knorpelschaden, kann eine Mikrofrakturierung oder Pridie-Bohrung infrage kommen. Dabei werden am geschädigten Knorpel mehrere Kanäle bis in den Knochen gebohrt. So gelangen Wachstumsfaktoren aus dem Knochenmark in den Knorpeldefekt, sodass sich dort Ersatzknorpel aus Narbengewebe bilden kann. Bei eher großflächigen Schäden kann die Abrasionsarthroplastik zum Einsatz kommen. Auch hier wird der Knochen, nachdem ausgefranste Knorpelteile entfernt wurden, mithilfe einer kleinen Fräse dazu stimuliert, Ersatzknorpel zu produzieren. Zu den Knorpel-Transplantations-Verfahren gehört die Knorpel-Knochen-Transplantation (Mosaikplastik). Dabei wird Knorpel von einer gesunden, wenig belasteten Stelle entnommen und danach in den Defekt eingepflanzt. Die autologe Chondrozyten-Transplantation (ACT) zielt darauf ab, neuen, körpereigenen Knorpel im Labor nachzuzüchten und den Defekt damit zu versorgen. Dazu werden in einem ersten Eingriff kleine Knorpelstückchen entnommen. Das so gezüchtete Transplantat wird dann in einem zweiten Schritt – meist in Form von Kügelchen ohne Matrixabdeckung oder auch gebunden an eine Trägermatrix – eingebracht. Eine weitere Möglichkeit, Knorpeldefekte zu versorgen, ist die Verwendung eines neuartigen Füllmaterials, das aus Kollagen besteht. Ein solches biologisches Kollagenimplantat besteht aus einer zellfreien Kollagen-Typ-1-Matrix. Diese dient im Knorpeldefekt als Platzhalter, in den Chondrozyten einwandern sollen. Das Implantat steht in flüssiger Form zur Verfügung und wird injiziert. Es kann sich also jeder Defektgröße anpassen und erfordert nur einen einzigen Eingriff.
von Silvana Dietzendorff
Wie ist Knorpel aufgebaut?
Als Chondroblasten bezeichnet man die knorpelaufbauenden Zellen. Ihre Aufgabe besteht in der Bildung der Chondrozyten, der eigentlichen Knorpelzellen. Die knorpelabbauenden Zellen werden als Chondroklasten bezeichnet. Je nach Knorpelart ist der Anteil dieser Zelltypen unterschiedlich groß. Die Chondrozyten als die eigentlichen Knorpelzellen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich nicht weiter teilen und viel Fett, Wasser und Glykogen enthalten. Zu ihren wichtigen funktionellen Bestandteilen gehören das endoplasmatische Retikulum und der Golgi-Apparat. Wie im Knochen finden auch im Knorpel ständige Auf- und Abbauprozesse statt, welche im Idealfall ausgeglichen ablaufen sollten. Da Knorpel nicht durchblutet wird, ist er kaum regenerationsfähig. Seine Nährstoffversorgung wird allein durch Diffusion gewährleistet, ein Vorgang, der durch die Knorpelhaut und die Gelenkflüssigkeit gefördert wird. Dabei werden Nährstoffe aus der Knorpelumgebung genutzt.




