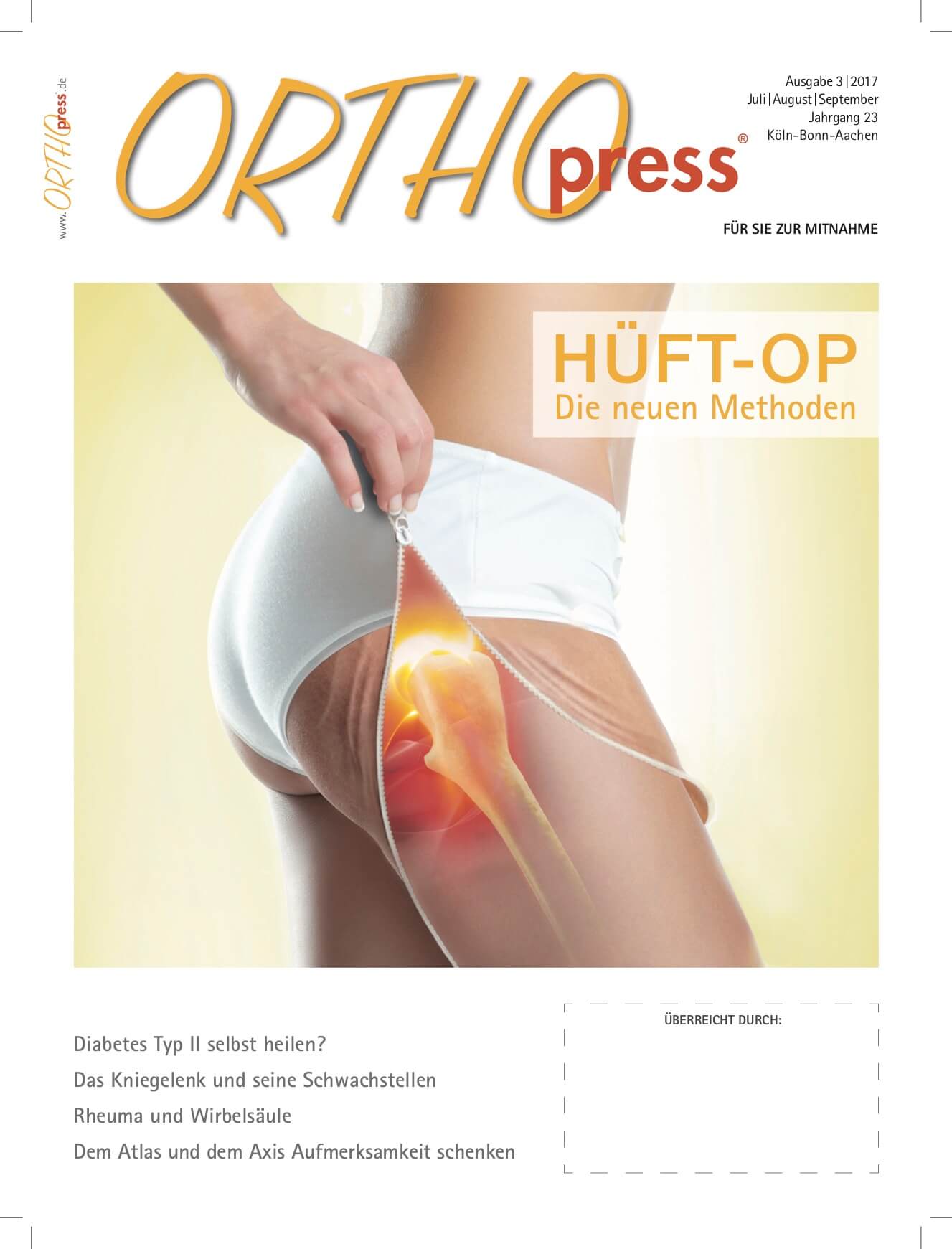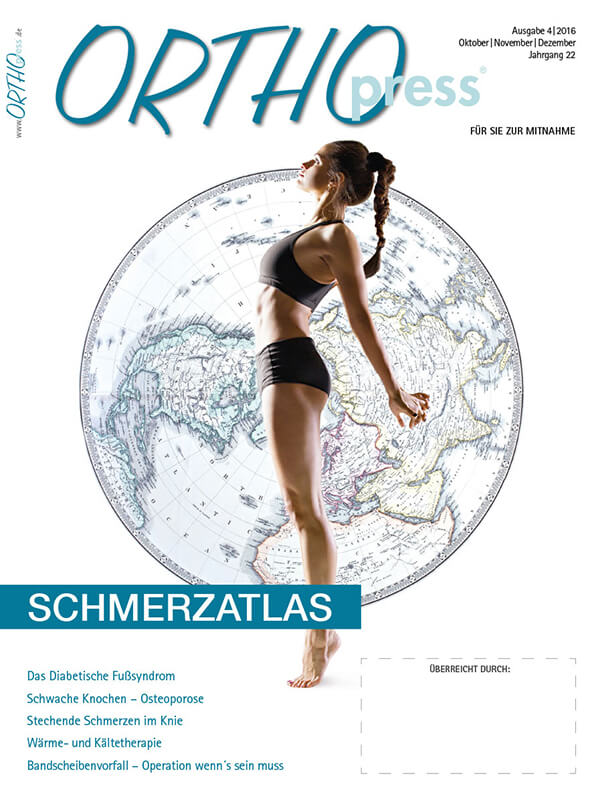Grauer und grüner Star (Katarakt und Glaukom) sind Erkrankungen, die zu einer eingeschränkten Sehfunktion führen. Ohne rechtzeitige Behandlung können sie im schlimmsten Fall eine Erblindung hervorrufen. Allerdings sind die Therapiemöglichkeiten hierzulande so gut, dass dies nur selten geschieht.
Meist entwickeln sich die beiden Erkrankungen schleichend in der zweiten Lebenshälfte. Die Bezeichnung Star hat übrigens nichts mit dem gleichnamigen Singvogel zu tun, sondern ist auf den starren Blick zurückzuführen, der die Betroffenen in früheren Zeiten ausgezeichnet hat, wenn die Erkrankungen unbehandelt blieben. Diese Situation hat sich aber, zumindest in den westlichen Ländern, inzwischen grundlegend geändert. Mittlerweile ist die Operation des grauen Stars einer der hierzulande am häufigsten durchgeführten chirurgischen Eingriffe; anders in Entwicklungsländern, wo es durch den Katarakt und das Glaukom immer noch zu schweren Sehschäden bis hin zur Erblindung kommt.
Die Bezeichnungen „grau“ und „grün“ beziehen sich auf das äußere Erscheinungsbild der Erkrankung. So wird die Linse beim grauen Star nach und nach trüber, während sie sich später gräulich verfärbt. Aufgrund der Trübung blicken die Betroffenen wie durch einen Nebel. Beim grünen Star treten bogenförmige Gesichtsfeldausfälle sowie eine meeresähnliche Verfärbung der Regenbogenhaut auf.
Der graue Stark (Katarakt)
Der graue Stark (Katarakt)
Die genaue Ursache der Linsentrübung konnte bislang noch nicht vollständig geklärt werden. Zumindest weiß man, dass Menschen, die unter Diabetes mellitus oder der Hautkrankheit Vitiligo leiden, häufiger betroffen sind, sodass ein gewisser Zusammenhang vermutet wird. Zu den weiteren Risikofaktoren gehören UV-Strahlen sowie eine verstärkte Einnahme bestimmter Medikamente oder Drogen. In Entwicklungsländern gilt die Erkrankung auch als Folge von Mangelernährung. Im Allgemeinen ist der Katarakt jedoch als Alterserkrankung zu betrachten. Während die Mehrheit der Betroffenen älter als 60 Jahre ist, sind auch Fälle von jüngeren Patienten bekannt. In der Regel sind sie besonders stark den genannten Risikofaktoren ausgesetzt. Darüber hinaus können auch Säuglinge, deren Mütter während der Schwangerschaft eine Rötelinfektion erlitten haben, von der Erkrankung betroffen sein.
Meist verläuft der graue Star schleichend und ist nicht schmerzhaft. Vielfach werden die ersten Einschränkungen der Sehkraft verharmlost und als altersbedingtes Phänomen abgetan. Tückischerweise führt der graue Star manchmal sogar zu einer vermeintlichen kurzfristigen Verbesserung der Sehkraft, so wie ja auch die Kurzsichtigkeit manchmal durch eine altersbedingte Weitsichtigkeit ausgeglichen werden kann. Daneben treten Symptome auf, die über eine alterstypische Sehschwäche hinausgehen. Dazu gehören eine erhöhte Lichtempfindlichkeit, Beeinträchtigungen des räumlichen und Farbsehens sowie ein reduziertes Kontrastsehen von hell und dunkel. Längerfristig führt eine getrübte Linse zu Sehbeeinträchtigungen, sowohl in Bezug auf die Nähe als auch die Weite.
Zu Beginn der Erkrankung genügt die Verwendung einer angepassten Brille zur Kompensation der Sehschwäche. Im fortgeschritteneren Stadium sollte der graue Star jedoch operiert werden. Dabei handelt es sich in der Regel um einen kleinen Eingriff, der sich im Allgemeinen ambulant durchführen lässt. Bei dem Eingriff wird die getrübte Linse per Ultraschall oder Laser entfernt und durch eine künstliche ersetzt. Es besteht die Möglichkeit, die neue Linse so auszuwählen, dass sie zugleich die zuvor bestehende Fehlsichtigkeit ausgleicht. Daher können zahlreiche Patienten nach einer Operation des grauen Stars auf ihre alten Brillen verzichten, müssen allerdings in der Regel eine Lesehilfe nutzen. Denn anders als es bei der natürlichen Linse der Fall ist, kann sich die Ersatzlinse nicht auf verschiedene Weiten einstellen. Meist verbessert sich die Wahrnehmung von Farben und Kontrasten unmittelbar nach dem Eingriff. Bereits ein bis zwei Monate später, wenn die Heilung endgültig abgeschlossen ist, hat sich die endgültige Sehstärke gefestigt. Um die Sehfähigkeit auf beiden Augen gleich zu halten, wird nach der Heilung des einen auch das andere Auge operiert.
Der grüne Star (Glaukom)
Zu den Risikofaktoren für einen grünen Star gehören eine genetische Disposition, Diabetes sowie eine stark ausgeprägte Kurz- und Weitsichtigkeit. Verantwortlich für die Sehschäden bei einem grünen Star ist nicht eine Veränderung der Linse, sondern ein geschädigter Sehnerv. Ursache ist meist ein erhöhter Augeninnendruck, der durch das Kammerwasser entsteht, das der Nährstoffversorgung des Auges dient. Produziert wird das Kammerwasser im Auge, von wo es normalerweise auch wieder abfließt. Ist dieser Abfluss jedoch gestört, steigt der Augeninnendruck immer weiter an, da die Produktion von Kammerwasser weitergeht. Auf diese Weise wird der Sehnerv geschädigt. Geraten wird daher vor allem Über-40-Jährigen, ihren Augeninnendruck regelmäßig kontrollieren zu lassen. Dies gilt auch für Menschen mit extremer Kurzsichtigkeit oder Personen, denen bekannt ist, dass der grüne Star in ihrer Familie bereits vorgekommen ist.
Wie beim grauen treten die Beschwerden auch beim grünen Star oft erst im Laufe der Erkrankung deutlich zutage. Charakteristisch sind Gesichtsausfälle, die man sich in etwa so vorstellen muss, als blicke der Betroffene durch eine verschmutzte Kameralinse. Unbehandelt kommt es zu einer zunehmenden Verschlechterung des Sichtfeldes.
Als spezieller Ausnahmefall ist der sogenannte akute Glaukomanfall zu betrachten. Dabei wird das Kammerwasser ganz plötzlich am Abfließen gehindert, dass der Augeninnendruck besonders extrem ansteigt. Die Folgen sind starke Augen- und Kopfschmerzen sowie Übelkeit. Eine sofortige Behandlung ist in einem solchen Fall dringend geboten.
Die Therapie eines Glaukoms zielt in erster Linie darauf ab, den Augendruck zu senken bzw. konstant zu halten. Erreichen lässt sich dies durch spezielle Augentropfen oder einen chirurgischen Eingriff, der für einen besseren Abfluss des Kammerwassers sorgt. Allerdings ist es auf diese Weise nicht möglich, bereits entstandene Schäden wieder rückgängig zu machen.
von Silvana Dietzendorff